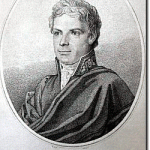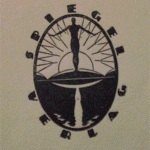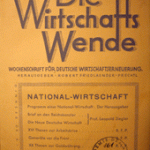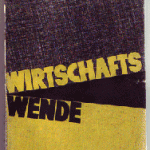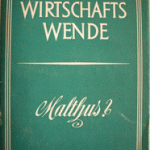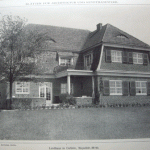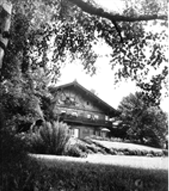Die Vorfahren
Die Vorfahren Friedlaender und Prechtl
Porträt Johann Joseph Prechtls (1778-1854) als
junger Direktor des Wiener Polytechnikums (um 1815)
Vater Josef Friedländer, 10. Okt. 1836 Oppeln/Preußen – 2. Febr. 1905 Wien, war Ingenieur und Besitzer einer Fabrik für Landwirtschaftsmaschinen. Mutter Beatrix Prechtl, 24. März 1853 Wien – 29. Mai 1919 Wien, verkörperte im großbürgerlichen Haus der Familie das kunstsinnige Element und nach ihr nannte sich Robert Friedlaender-Prechtl in seinen literarischen Arbeiten: Robert Prechtl. Ein Vorfahre, der Physiker und Chemiker Johann Joseph Ritter von Prechtl, war 1814 der Gründer des Wiener Polytechnikums.
(more…)
Familie
Familie Robert Friedlaender-Prechtl
Ehefrau Meta Zahn, 29. Febr. 1872 Giebichenstein b. Halle/Saale – 13. Mai 1950 Starnberg, war professionelle Sängerin (Mezzosopran). 1895 debütierte sie unter dem Namen Magda Lossen. 1896 heiratete sie den Berliner Gutsbesitzer und Tenor Franz Henry von Dulong (26. Febr. 1861 Hamm, Westfalen-13.4.1944 Garmisch-Partenkirchen) und trat mit ihm international auf; die Literatur nennt Schallplattenaufnahmen von 1904 bei G&T (Gramophone and Typewriter). Nach beider Gesangskarriere arbeiteten sie als Pädagogen. 1897 wurden die Zwillinge Ingeborg (gest. 1935) und Irmela (gest. 1985) geboren.
(more…)
Verwandtschaft
Friedrich Victor (Fritz) von Friedlaender-Fuld
30. August 1858 Gleiwitz, Oberschlesien – 16. Juli 1917 Gut Lanke b. Bernau/Brandenburg
Mit seiner unternehmerischen Leistung und dem daraus erwachsenen Vermögen erreichte er Besitz und Titel, wie sie im Deutschen Reich der Kaiserzeit nach der Staatsgründung 1871 möglich und erstrebt waren. Wie sein Neffe Robert Friedlaender-Prechtl sah er sich als Jude assimiliert. Er trat 1896 aus der Jüdischen Gemeinde aus und wurde evangelisch. 1906 erhielt er den preußischen Adelstitel, war Kgl. Geh. Kommerzienrat und Mitglied des preußischen Herrenhauses; in Schlesien besaß er mehrere Güter. (more…)
Unternehmer &
|
Emblem des SPIEGEL-Verlags 1919-1921 |
Zs. Wirtschafts-Wende, 30.9.1931 |
Wirtschafts-Wende, 1931 |
Malthus? 1948 |
Bauherr
|
Landhaus Berlin-Dahlem 1912 |
Haus Ruland, Kempfenhausen 1928 |
Haus Ruland, Musikzimmer 1928 |
Im Birkenhof, Percha, 1950er Jahre |
Robert Friedlaender-Prechtl war Bauherr für vier große Häuser in Berlin und am Starnberger See, Oberbayern.
Verleger & Herausgeber
Zweimal – in schwierigen Zeiten – war Robert Friedlaender-Prechtl als Herausgeber von Zeitschriften an die Öffentlichkeit getreten, mit denen er Diskussionen zu den anstehenden Problemen anregen wollte: in den politischen Umbrüchen nach dem 1. Weltkrieg zu Beginn der Weimarer Republik und an ihrem Ende in der Wirtschaftskrise 1929/31.
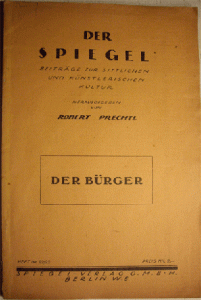 |
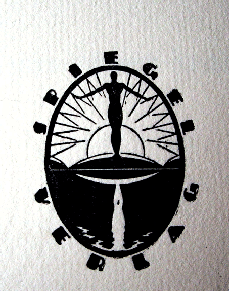 |
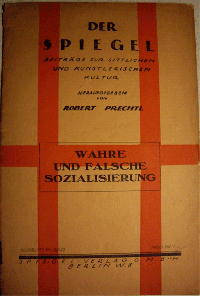 |
Oppeln 1944
„OPPELN / aus einem Lebensrückblick“, undatiert [um 1944]
Oppelner Ring in Oppeln im Jahr 1904
Vom Vater her stamme ich aus jüdischem Blut. Diese Ahnenlinie kann ich nicht weiter als bis zum Urgroßvater verfolgen. Dieser lebte in Preußisch-Schlesien, in jenem Winkel um Ratibor der damals ‚Wasser-Polen’ genannt wurde. Hier lebten durcheinander gemischt Deutsche und Polen mit einem ziemlich starken Einschlag von Juden. Diese unterschieden sich aber wesentlich von den in Russisch-Polen ansässigen, die in strenger, alttestamentarisch gefärbter, Abgeschlossenheit lebten, in einem religiös bestimmten selbstgewollten Ghettoleben. (more…)
Vita 1947
Lebenslauf
Robert Friedlaender‐Prechtl
Ich bin in Wien am 31. Mai 1874 geboren. Mein Vater Josef Friedlaender war Reichsdeutscher, gebürtig in Oppeln. Meine Mutter Beatrix von Prechtl war die Enkelin des Begründers des Wiener Polytechnikums, der ersten technischen Hochschule auf dem Kontinent. Er hat auch – vor genau 100 Jahren – die erste wissenschaftliche Untersuchung über den ‚Flug der Vögel’ angestellt; er gilt als ein Erzvater der Aviatik. (more…)
Tod
‚Voll zog ich aus, – aber leer /
hat mich der Herr wieder heimgebracht.’ (Ruth I. 21)
Diese Losung nannte Robert Friedlaender-Prechtl in seiner letztwilligen Verfügung vom 1. Juli 1950 – für „meinen hoffentlich letzten Geburtstag“ –, der am 13. August bevor stand. Über die Umstände seines Todes wenige Wochen nach dem seiner Frau Meta im Mai ist wenig bekannt, aber seine Kräfte hatten schon länger nachgelassen.
(more…)
Quellen
Unveröffentlichte Quellen
Ergiebige Quellen für meine Recherchen waren und sind die Berliner Adress-Bücher, Antiquariate und das Internet.
Außerdem:
Zentralbibliothek Zürich: Mus NL 59, Nachlassverzeichnis Hans Schaeuble Stiftung, Requiem op 6, verschiedene Fassungen [noch nicht gesichtet].
Österreichische Nationalbibliothek, Musikerbriefe, Nr. 1162: Robert Friedlaender-Prechtl an Joseph Marx (11.5.1882 Graz–3.9.1964 Graz), Komponist, Musikpädagoge, Kritiker, Briefe Nr. 817/36-1 bis 817/36-10, Zeitraum 14.12.1934-29.5.1946; dabei Liste seiner veröffentlichten und nicht veröffentlichten Werke und Entwurf zu einem Buch (Buch Rahel) mit Vorwort.
Literatur
Gedruckte Quellen und Literatur
Barkai, Avraham: Das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus. Ideologie, Theorie, Politik 1933-1945. Köln 1977, erw. Neuausgabe Frankfurt a.M. 1988
Barkai, Avraham: Erlebtes und Gedachtes. Erinnerungen eines unabhängigen Historikers. Göttingen 2011, S. 78–104
Christiane Berg: Rilkes Berliner Begegnung mit Marianne von Friedländer-Fuld. In: Aus dem Antiquariat 1975/I, Beilage zum Börsenblatt f.d.Dt. Buchhandel, Frankfurter Ausg. Nr. 9, 31.
Berliner Architekturwelt, 16.1914: Otto Bartning
Blätter für Architektur und Kunsthandwerk, 27.1914, Heft 10: Otto Bartning
Breslauer, Alfred: Ausgeführte Bauten 1897–1927. Mit einer Einleitung Wilhelm von Bodes unter Mitarbeit von Hermann Schmitz. Berlin 1927
Bunsen, Marie von: Zeitgenossen, die ich erlebte 1900 – 1930. Leipzig 1932: 12.11.1918: “Fürst Blücher und Fritz Friedländer-Fuld haben hingegen auf dem Pariser Platz die rote Fahne aufgezogen. Ebenfalls Prinz Friedrich Leopold von Preußen auf Schloß Glienicke: Darauf äußerten sich die Roten verächtlich über solche Jammerlappen.”
Büttner, Ursula: Politische Alternativen zum Brüningschen Deflationskurs. Ein Beitrag zur Diskussion über „ökonomische Zwangslagen“ in der Endphase von Weimar. In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 37.1989, H. 2
Calder, William M. III, Kosenina, Alexander: Poesie, Philologie und Politik: Ulrich von Wilamowitz-Moellendorffs (1848-1931) Briefwechsel mit Robert Friedlaender (1874–1950). In: Antike und Abendland (1990), herausgegeben von Albrecht Dihle u.a. Berlin, New York 2009